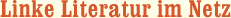Die Liebe zur Kunst
Alle Preise inkl. MwSt.
| zzgl. Versand
Nicht verfügbar
Zum Merkzettel
Gewicht:
305 g
Format:
211x131x12 mm
Beschreibung:
Pierre Bourdieu ( 1. August 1930 in Denguin, Pyrénées-Atlantiques; gest. 23. Januar 2002 in Paris) war einer der bekanntesten Soziologen des 20. Jahrhunderts. Er studierte Philosophie in Paris an der École Normale Supérieure. Mit einem Buch über den Aufenthalt in Algerien 1958 - 1960 ("Die zwei Gesichter der Arbeit") begründete er seine Reputation als Soziologe. Seit 1981 hatte Bourdieu einen Lehrstuhl am Collège de France. Im Jahre 1993 wurde er mit der "Médaille d'or du Centre National de la Recherche Scientifique" (CNRS) ausgezeichnet. Pierre Bourdieus soziologische Forschungen, zumeist im Alltagsleben verwurzelt, waren vorwiegend empirisch orientiert. Er war bekannt als politisch interessierter und aktiver Intellektueller, der sich gegen die herrschende Elite und den Neoliberalismus wandte. Stephan Egger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität St. Gallen.
Der Zugang zu den Schätzen der Kunst steht allen offen und bleibt doch tatsächlich den meisten verwehrt.Nach wie vor gilt der Befund, den Pierre Bourdieu und Alain Darbel vor 40 Jahren als Ergebnis der vorliegenden Studie formulierten:"Der Anteil der verschiedenen sozio-professionellen Kategorien im Publikum der Museen (...) steht nahezu in umgekehrtem Verhältnis zu ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung."Wenn der Kunstliebhaber einer Neigung folgt, die frei von allen Voraussetzungen und Zwängen scheint, dann bleibt das Museum einer der Orte, an denen die Schwerkraft gesellschaftlicher Erwartungen besonders deutlich spürbar wird. Verdankt sich die Liebe zur Kunst nicht mindestens ebenso einem Gebot"gehobener Sitten"wie der Eingebung des Herzens?
Längst ein heimlicher Klassiker der Kultursoziologie, versucht dieses Buch, das damals schon"Die feinen Unterschiede"ankündigt, auf solche Fragen empirische Antworten zu geben, den"guten Geschmack"einer wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. Indem es die gesellschaftlichen Bedingungen der Möglichkeit kultureller Praxis offen legt, beweist es, dass Kultur kein natürliches Privileg ist, sondern eine besondere Erziehung und Bildung als Mittel ihrer Besitzergreifung voraussetzt, die die Klassengesellschaft höchst ungleich verteilt.
Längst ein heimlicher Klassiker der Kultursoziologie, versucht dieses Buch, das damals schon"Die feinen Unterschiede"ankündigt, auf solche Fragen empirische Antworten zu geben, den"guten Geschmack"einer wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. Indem es die gesellschaftlichen Bedingungen der Möglichkeit kultureller Praxis offen legt, beweist es, dass Kultur kein natürliches Privileg ist, sondern eine besondere Erziehung und Bildung als Mittel ihrer Besitzergreifung voraussetzt, die die Klassengesellschaft höchst ungleich verteilt.
Der Zugang zu den Schätzen der Kunst steht allen offen und bleibt doch tatsächlich den meisten verwehrt.
Nach wie vor gilt der Befund, den Pierre Bourdieu und Alain Darbel vor 40 Jahren als Ergebnis der vorliegenden Studie formulierten: "Der Anteil der verschiedenen sozio-professionellen Kategorien im Publikum der Museen [...] steht nahezu in umgekehrtem Verhältnis zu ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung."
Wenn der Kunstliebhaber einer Neigung folgt, die frei von allen VorausSetzungen und Zwängen scheint, dann bleibt das Museum einer der Orte, an denen die Schwerkraft gesellschaftlicher Erwartungen besonders deutlich spürbar wird. Verdankt sich die Liebe zur Kunst nicht mindestens ebenso einem Gebot "gehobener Sitten" wie der Eingebung des Herzens?
Längst ein heimlicher Klassiker der Kultursoziologie, versucht dieses Buch, das damals schon Die feinen Unterschiede ankündigt, auf solche Fragen empirische Antworten zu geben, den "guten Geschmack" einer wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. Indem es die gesellschaftlichen Bedingungen der Möglichkeit kultureller Praxis offen legt, beweist es, dass Kultur kein natürliches Privileg ist, sondern eine besondere Erziehung und Bildung als Mittel ihrer Besitzergreifung vorausSetzt, die die Klassengesellschaft höchst ungleich verteilt.
"Anstatt sich mit Primitivbefragungen zu begnügen, die nichts anderes als Besucherzahlen anhäufen, wurde hier die Enquête so ausgerichtet, dass sie diejenigen sozialen Bedingungen hervorbringt, die Zugang verleihen zur Kulturausübung, d.h. zum Museumsbesuch. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, verdeutlicht uns die Untersuchung, daß die Kunst bzw. in diesem Fall die Kunstbetrachtung als Kunsterlebnis von Natur aus kein Privileg darstellt - eine Ansicht, die leider noch allzu oft von seiten selbsternannter Kunstpropheten nicht geteilt wird." Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Nach wie vor gilt der Befund, den Pierre Bourdieu und Alain Darbel vor 40 Jahren als Ergebnis der vorliegenden Studie formulierten: "Der Anteil der verschiedenen sozio-professionellen Kategorien im Publikum der Museen [...] steht nahezu in umgekehrtem Verhältnis zu ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung."
Wenn der Kunstliebhaber einer Neigung folgt, die frei von allen VorausSetzungen und Zwängen scheint, dann bleibt das Museum einer der Orte, an denen die Schwerkraft gesellschaftlicher Erwartungen besonders deutlich spürbar wird. Verdankt sich die Liebe zur Kunst nicht mindestens ebenso einem Gebot "gehobener Sitten" wie der Eingebung des Herzens?
Längst ein heimlicher Klassiker der Kultursoziologie, versucht dieses Buch, das damals schon Die feinen Unterschiede ankündigt, auf solche Fragen empirische Antworten zu geben, den "guten Geschmack" einer wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. Indem es die gesellschaftlichen Bedingungen der Möglichkeit kultureller Praxis offen legt, beweist es, dass Kultur kein natürliches Privileg ist, sondern eine besondere Erziehung und Bildung als Mittel ihrer Besitzergreifung vorausSetzt, die die Klassengesellschaft höchst ungleich verteilt.
"Anstatt sich mit Primitivbefragungen zu begnügen, die nichts anderes als Besucherzahlen anhäufen, wurde hier die Enquête so ausgerichtet, dass sie diejenigen sozialen Bedingungen hervorbringt, die Zugang verleihen zur Kulturausübung, d.h. zum Museumsbesuch. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, verdeutlicht uns die Untersuchung, daß die Kunst bzw. in diesem Fall die Kunstbetrachtung als Kunsterlebnis von Natur aus kein Privileg darstellt - eine Ansicht, die leider noch allzu oft von seiten selbsternannter Kunstpropheten nicht geteilt wird." Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie